Wer Oboist werden will, muss hobeln lernen. Denn der Eigenbau des Mundstücks mit dem Doppelrohrblatt ist essenziell. An der RSH bringt eine ausgewiesene Spezialistin diese Kunst Studierenden der Klasse Ralph van Daal bei: Alexandra Hajdu. Wir durften mal zuschauen.

Alexandra Hajdu und Ralph van Daal. Foto: Susanne Diesner
Hobeln, schaben, krähen
Hört man sich unter Profi-Musikern um, gelten Oboisten (und da sind hier ausdrücklich auch die nicht-männlichen gemeint) als besonders verrückt. Zumindest was ihre Obsession mit den Mundstücken anbetrifft. Die gold-warmen Hochtöner unter den Holzbläsern erwecken nämlich den Anschein, als seien in den ledernen oder hölzernen Etuis, die sie neben einem obligaten winzigen wassergefüllten Becherchen mit sich herumtragen, wenn sie zur musikalischen Tat schreiten, geradezu magische Gegenstände aufbewahrt. Und fragt man Alexandra Hajdu, dann ist das auch so: Oboen-Mundstücke spüren, ob sich ihr Spieler gerade energiegeladen oder eher matt fühlt, ob der Saal voll ist oder leer, ob Sommer oder Winter und wie das Wetter draußen ist sowieso. Sie interagieren mit der Gestalt der Lippen, der Fitness der sie straffenden Gesichtsmuskeln, mit der Spannung des Zwerchfells, nicht zuletzt mit der Art der Musik, die durch sie zum Klingen gebracht werden soll. Alexandra Hajdu baut Oboen-Mundstücke und an der RSH bringt sie den Studierenden bei, wie man das macht. Das ist für alle ein Glück.
Rohrbau derart intensiv zu lehren ist an deutschen Musikhochschulen eher ungewöhnlich, obwohl bei Abschlussprüfungen selbstgebaute Mundstücke meist Pflicht sind. Und auch an der RSH steht Rohrbau noch nicht explizit in der Studienordnung.
Dass sich das in naher Zukunft ändert, dafür setzt sich Ralph van Daal ein, der für die Studierenden seiner Oboen-Klasse die Rohrbau-Ausbildung verpflichtend macht. „Mir, uns ist es wichtig, dass die Studierenden lernen, beim Rohrbau selbstständig zu werden“, sagt van Daal. Mit Alexandra Hajdu, die seit 2021 an der RSH lehrt, weiß er eine ausgesprochene Spezialistin an seiner Seite. Die Dozentin für Englischhorn und Fachdidaktik verfügt nach diversen Lehraufträgen an anderen Hochschulen über eine besondere Expertise in Sachen Rohrbau. Die positiven Auswirkungen ihres Unterrichts auf die Qualität der Ausbildung sind bei Studierenden wie Lehrern schon jetzt unbestritten. Wir durften der „Rohrbau-Zauberin“ mal auf die Finger schauen.
Der Stahlschrank mit den Werkzeugen steht in einem normalen Unterrichtsraum der Hochschule. Er beherbergt neben Material und Messern vor allem recht teure Präzisionsmaschinen, die auf die Erfordernisse der verschiedenen Holzblasinstrumente abgestimmt sind. „Die Hochschule ist uns bei der Anschaffung sehr entgegengekommen, unsere Studierenden können sie hier benutzen lernen und später ausleihen“, sagt Alexandra Hajdu. Bis die ungemein freundliche und zugewandte junge Frau alles fein ordentlich auf den Tisch gelegt hat, was sie und uns die kommenden Stunden beschäftigen wird, darf der Besucher schon mal in einen halbspitz zugeschnittenen und plattgedrückten Plastik-Halm pusten. Nach ein paar Versuchen quäkt‘s. Das ist das Prinzip Doppelrohrblatt. Auf dem Tisch liegt inzwischen ein stattliches Arsenal an Werkzeugen und Maschinen.
Das Rohr
Am Anfang ist das Rohr. Genau genommen das Pfahlrohr, botanisch Arundo donax, ein schilfähnliches Süßgras, das bis zu sechs Meter hoch wird. Dessen Stängel werden, härter als Bambus, geschnitten, getrocknet, in hohle, rund 12 cm lange Stücke geteilt. Oboisten schauen unter anderem auf Herkunft, Jahrgang, Farbe und zahlen rund 300 Euro fürs Kilo. Frau Hajdu kramt ein wenig in einem bis zum Rand gefüllten Pappkarton und wählt zwei unterschiedlich dicke Stängelstücke mit einer Lehre aus, die den Durchmesser ermittelt. Rund 10 mm für Oboe, rund 12 fürs Englischhorn. Sie schaut auf gleichmäßig hellgelbe, glänzende Farbe, mag gerieftes Holz nicht so gern und will ein möglichst gerades Stück haben. Das hört sich sehr nach viel Erfahrung an.
Spalten
Dann kommt eine Art Kartoffelmesser zum Einsatz, das das Rohr genau da längs aufspaltet, wo es am geradesten ist, damit es passgenau ins Bett einer Maschine zu liegen kommt. Vorher längt noch eine Guillotine das Stück auf 75 mm ab, dann tritt die Hobelmaschine in Aktion.
Hobeln
Rund 1500 Euro kostet so ein Messinggerät, das mit scharfen Messern Späne aus dem Bastteil des Rohrstücks hobelt, so lange, bis das Stück genau 0,56 bis 0,58 mm dünn ist. Präzision der Maschine paaren sich mit Fingerspitzengefühl der Bedienerin, die Skala des Dickenmessers bestätigt das gewünschte Ergebnis. Die Späne sind eine prima Deko fürs Osternest, verrät Frau Hajdu. Das Ergebnis der Hobelei ist ein dünnes, langes, in sich biegsames Stück Holz, innen hellweiß, fest, außen glänzend hart.
Fassonieren
Diesem rechteckigen, in Wasser eingeweichten Stück schneidet eine weitere Maschine die Kanten ab. Und zwar so, dass es wie ein Schiffsrumpf in der Draufsicht aussieht. Für diese „Fasson“ gibt es unterschiedlich breite Einsätze, je nach Anforderung an die Spielbarkeit und den Klang des späteren Mundstücks. Breite Fassons geben einen tiefen, vollen Ton, schmale einen schlanken, obertonreichen Klang. Dann kommt der Clou: Damit aus dem dünnen Holzstück ein Doppelrohr wird, muss es genau in der Mitte geknickt und präzise aufeinandergelegt werden. Die Markierung dazu hat die Hobelmaschine schon eingedrückt, die Fachfrau nimmt einen Messerrücken zur Hand und biegt das etwa 30 Minuten in Wasser eingeweichte Holz so, dass die glänzende Seite außen bleibt. Fertig ist die „Puppe“.
Aufbinden
Jetzt kommen diverse Messer und Schaber zum Einsatz, die die Puppe am offenen Ende schlanker, anschmiegsamer machen. Denn diese Seite muss an der Messinghülse befestigt werden, die später auf die Oboe gesteckt wird. Auch das ist ein Präzisionsteil, das passgenau auf das im Querschnitt ovale und konisch gebohrte Loch im Oboenkörper eingepasst ist. Die Puppe wird aufgesetzt, an der Querlinie des Ovals ausgerichtet und mit einem Messingdraht („Zwinge“) fixiert. Wenn alles richtig sitzt (auch das sieht sehr nach Erfahrung aus), wird das Rohr mit Garnen fest um die Hülse gewickelt. Frau Hajdu schwört auf Knopflochgarn aus Polyester. Mit einem feinen Trick gibt’s einen Knoten und zwei Fadenenden, die kurzgeschnitten abstehen.
Schaben
Wenn bis hierhin alles gut gegangen ist, sollte auch das Öffnen des Rohrs kein Problem sein: Das geschlossene Ende wird, nachdem es mithilfe von Schabemaschinen und Handschabern (so ein Messer aus Fernost kostet schon mal 250 Euro) bis über die Hälfte von der starren Außenhaut befreit wurde, bei 71 mm Länge abgeknipst. Wenn jetzt die beiden Seiten dicht aufeinanderliegen, keine Fremd-Luft ziehen, kann es an die Feinarbeit gehen. Sonst muss vorher noch Mal eine Nagelfeile ran. Dazu stehen wieder Maschinchen bereit, die eine erprobte Form auf das Rohrblatt übertragen. Am Ende regiert dann wieder der Hand-Schaber.
Krähen
Bei den letzten Fertigungsschritten kommt auch das Ohr zum Einsatz, das die Qualität der ersten geblasenen Töne bewertet. „Jetzt kräht mein Rohr“, sagt Alexandra Hajdu irgendwann zufrieden. Rund vier Stunden sind ins Land gegangen, nun sollte das neue Mundstück ein paar Tage ruhen, wieder hervorgeholt, eingespielt, sanft hier und da beschabt werden. Und wenn es ganz gut geht, wird es seinen Weg in jenes sagenumwobene Etui finden, das ein Oboist mit auf die Bühne nimmt. Wie man hört, haben Orchestermusiker einen Bedarf von um die hundert Rohre im Jahr. Die Oboe-Studierenden an der RSH lernen also wichtiges Handwerk. Oder wie Ralph van Daal gerade auch in Hinblick auf die Kunst des Rohrbaus sagt: „Gute Musik kommt aus guter Technik.“
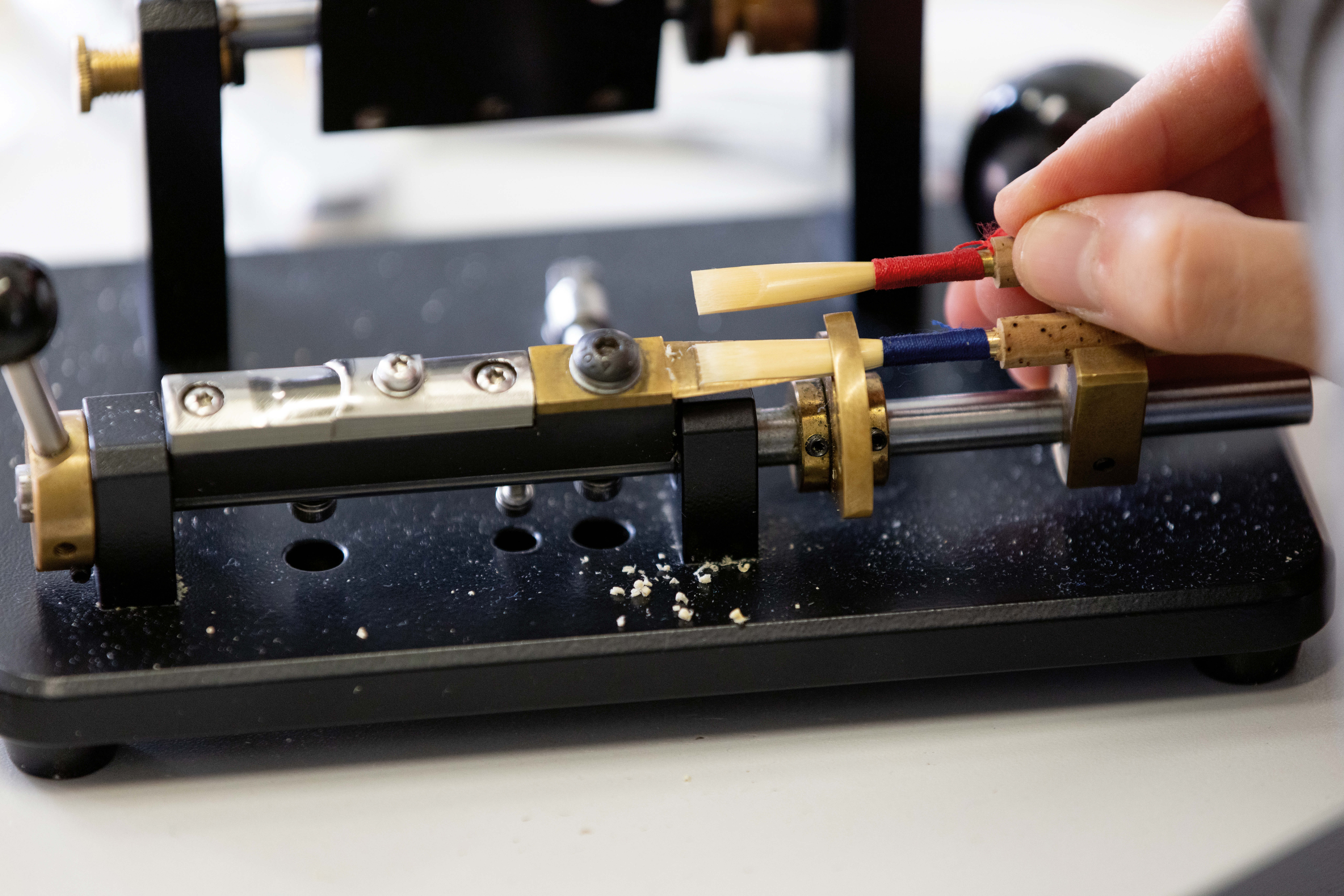
Foto: Susanne Diesner
- Share by mail
Share on