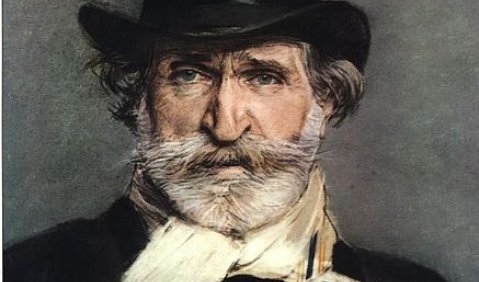1868 konnte man in einer der wichtigsten Kulturzeitschriften Italiens, in der „Nuova antologia“, lesen: „Giuseppe Verdi ist dem Einfluss seiner Zeiten ausgesetzt gewesen; er ist der Vertreter des musikalischen Eklektizismus in Italien, wie es Meyerbeer für Frankreich und Deutschland gewesen war.“ Da muss man zweimal hinschauen: Der Komponist, den wir als wichtigsten Italiener des 19. Jahrhunderts, als italienischsten aller italienischen Komponisten wahrnehmen, soll ein Eklektiker gewesen sein, einer, der sich in allen Traditionen bedient?
Ein musikalischer Allesfresser
Aber Francesco D’Arcais, der Musikkritiker aus Turin, hat Recht: Verdi hat sich in allen Traditionen bedient, er war ein musikalischer Allesfresser. Natürlich bedeutete am Beginn seiner Karriere das Werk Donizettis den wichtigsten Bezugspunkt für einen anfangs eher mechanischen, dann zunehmend individualisierten Umgang mit den Konventionen italienischer Oper. Ohne Zweifel war auch Rossini entscheidend für den zwanzig Jahre jüngeren Norditaliener. Verdi hat sich jedoch weit mehr an den Pariser Opern des Großmeisters orientiert, vor allem an „Le siège de Corinthe“, als an dessen italienischen Partituren. Ohne das Vorbild der Oper von 1826 mit ihren machtvollen Basspartien und Chorszenen wäre ein „Nabucodonosor“ nicht denkbar gewesen. In „Giovanna d’Arco“, aber auch schon in „I Lombardi alla prima Crociata“ versuchte Verdi, weitere Pariser Neuerungen zu übernehmen: die Schauerromantik von Meyerbeers „Robert le diable“ und das historische Gepränge von dessen „Les huguenots“.
Noch 1852 bezeichnete Verdi die Krönungsszene aus Meyerbeers „Le prophète“ als „Wunder“ und wünschte sich für seine erste neu komponierte französische Oper Ähnliches. 1853 modellierte er die eigentliche Hauptrolle von „Il trovatore“, die Zigeunermutter Azucena, als Mezzosopran mit dunklem Timbre nach dem Vorbild der Fidès aus dieser Oper Meyerbeers, 1859 präsentierte er mit „Un ballo in maschera“ in Rom ein „remake“ von „Gustave III ou Le bal masqué“, einer 1833 uraufgeführten Pariser Oper, 1862 kam er in seiner für Sankt Petersburg geschriebenen Oper „La forza del destino“ dem Revue-Charakter der großen historischen Oper so nahe wie nie zuvor.
Nur die deutsche Oper spielte für Verdis kompositorisches Denken keine Rolle, es sei denn, man würde Mozarts italienischen „Don Giovanni“ dieser Tradition zurechnen. Denn vor den ersten Aufführungen Wagners in Paris in den 1860er-Jahren wurde deutsche Oper im Ausland kaum wahrgenommen, selbst Webers „Der Freischütz“ wurde in Italien nach der Erstaufführung von 1843 kaum gespielt.
Dafür war das deutsche Theater umso prägender für Verdi: Fünfmal hat er Dramen Schillers bearbeitet, „Die Jungfrau von Orléans“ und „Die Räuber“, „Kabale und Liebe“ und „Don Karlos“ sowie – für den dritten Akt von „La forza del destino“ – „Wallensteins Lager“. Mit Lord Byron, Victor Hugo und dem Herzog von Rivas finden sich die wichtigsten Autoren des romantischen Theaters aus England, Frankreich und Spanien unter den „Stofflieferanten“ Verdis, und seit 1847, dem Jahr der Uraufführung des eigenwilligen „Macbeth“, interessiert sich der Komponist auch immer wieder für Shakespeare. Italienische Literatur ist dagegen in seinem Werk weitgehend unsichtbar. Nur eine einzige der fast dreißig Opern folgt einer literarischen Vorlage in italienischer Sprache: „I Lombardi alla prima Crociata“ aus dem Jahre 1843.
Nachahmer Wagners?
Wie ist es dann aber möglich, dass Verdi als italienischer Nationalkomponist wahrgenommen wurde und wird? Aus zwei Gründen: weil das im Jahre 1860 in einem Staat geeinte, aber politisch heillos zerstrittene Italien eine solche Identifikationsfigur brauchte. Auf den Theaterkomponisten, dessen Opern in Palermo genauso präsent waren wie in Turin, Venedig und Cagliari, ließen sich die heroischen Erinnerungen an einen nicht immer heroischen und vor allem äußerst konfliktreichen Freiheitskampf projizieren. Aber auch Verdi selbst, und das ist der zweite Grund, hatte irgendwann am Ende der 1860er- Jahre verstanden, dass er seinem Werk eine nationale Farbe geben musste, um im In- wie Ausland weiter erfolgreich sein zu können.
Bei der Komposition seines „Don Carlos“ hatte er noch versucht, einen spezifisch französischen Weg auszuschreiten. Er bediente das Pariser Publikum gerade nicht mit eingängigen Melodien italienischer Art, sondern entwickelte die vokalen Linien seiner Oper von 1867 aus dem Rhythmus der französischen Sprache. Wenn die Figuren der Tragödie ihren Emotionen besonderen Nachdruck verleihen, wählt er den französischen Vers par excellence, den Alexandriner, dessen zwölf Silben ungewöhnlich lange und weitgespannte Melodien erfordern.
Das Publikum zeigt sich freilich von diesen extravaganten Neuerungen nur gelangweilt. Noch weniger möchte sich die Pariser Kritik von einem Ausländer vorbuchstabieren lassen, was man musikalisch mit der französischen Sprache alles anstellen kann. Zwar sah sich Paris noch als kulturelle Hauptstadt Europas. Aber die Weichen für den geifernden Nationalchauvinismus, der sich erstmals 1870/71, dann aber vor allem in der Katastrophe des Ersten Weltkriegs entladen sollte, waren schon gestellt. Nun war es nicht mehr gern gesehen, wenn jemand wie Rossini, Donizetti oder Meyerbeer in einer anderen als der Muttersprache Opern schrieb. Schlimmer noch, und das weist auf ein weiteres Problem: Da die Pariser Intellektuellen in Wagners Schriften von der Forderung nach langen, gar „unendlichen“ Melodien in der Oper gelesen hatten, begriffen sie Verdis Versuch, aus dem Korsett der kurzatmigen, regelmäßigen und voraussehbaren Melodien à la „La donna è mobile“ auszubrechen, als plumpe Nachahmung des deutschen Fanatikers.
Dabei hatte Verdi damals Wagners Musik noch gar nicht zur Kenntnis genommen. Aber es kam noch schlimmer: Nach 1871 musste ein sichtbar entgeisterter Verdi mit ansehen, wie sich sogar in Italien die Eliten für Wagner begeisterten. 1898 wurde die Mailänder Scala nach einem Jahr ohne Aufführungen nicht etwa mit einer italienischen Oper, sondern mit Wagners „Meistersingern“ unter der Leitung Toscaninis wiedereröffnet. Verdis Opern aus den 1840er- und 1850er- Jahren, die zuerst am Geschmack der damals kulturtragenden Schichten, des Mailänder, venezianischen und römischen Adels ausgerichtet waren, wurden dagegen als leicht verdauliche Ware für die Mittelschichten, ja für die breiten Massen abgetan.
Was tat Verdi? In „Aida“, einer Oper, die in ihrem Aufbau Meyerbeers Modell der grandiosen historischen Oper verpflichtet ist und deren Sujet von einem Pariser Archäologen stammt, schlug er einen dezidiert italienischen Tonfall an. Mit „Celeste Aida“ komponiert er wieder kurze, eingängige Melodien, im dritten Akt sogar eine mitreißende „cabaletta“, einen schnellen Satz am Ende eines melodienseligen Duetts. Gleichzeitig experimentiert er weiter mit schweifenden, langen Vokallinien, die er aber nun auf die Tradition der italienischen Literatur bezieht. Von Antonio Ghislanzoni, seinem Verseschmied, verlangt er den „großen Vers, den Vers Dantes“, also den bisher für lyrische Nummern als unbrauchbar angesehenen Elfsilbler, um daraus eine so anrührende Melodie wie das „O terra, addio; addio valle di pianti …“ im Sterbeduett der Liebenden zu gewinnen.
Politik und soziale Konflikte
Aber auch in anderen Bereichen engagiert sich Verdi für die neue Nation: Von 1861 bis 1865 nimmt er Einsitz im ersten Parlament des neuen Staates, 1874 stellt er mit der „Messa da Requiem“ anlässlich des ersten Todestags des Nationaldichters Manzoni ein Werk vor, das nicht zuletzt zum Ruhm des Vaterlandes geschrieben ist. Von dieser Neuorientierung an der italienischen Tradition war es dann nur noch ein kleiner Schritt zur Denkfigur, die Verdi im Rückblick als musikalischen Vorkämpfer der italienischen Einigungsbewegung verklärte. Bereits in den 1860er-Jahren waren seine frühen Opern als musikalischer Ausdruck der erregten Epoche wahrgenommen worden, die später als „Risorgimento“ bezeichnet werden sollte. Zwar wussten die Zeitgenossen damals um das, was kritische Forschung in den letzten Jahren mühsam rekonstruiert hat, dass nämlich ein Chor wie das berühmte „Va pensiero sull’ali dorate“ aus „Nabucodonosor“ nicht als politischer Kampfruf gemeint sein und in den frühen 1840er- Jahren auch nicht als solcher verstanden werden konnte. Allerdings hatte sich in der vorrevolutionären Situation der Jahre 1846 und 1847 das Publikum nicht nur im von Österreich regierten Venedig am patriotischen Text einer Arie aus „Attila“ und an einem vaterländischen Chor aus „Macbeth“ begeistert.
Dennoch: Dieser kurze Flirt des „Risorgimento“ mit Verdis Musik hatte keine Dauer. Denn nach 1849 wählte Verdi nicht patriotische Sujets für seine Opern, sondern soziale wie in „Rigoletto“, „La Traviata“ und „Simon Boccanegra“, wobei allerdings auch die erheblich verschärfte Zensur in Rechnung zu stellen ist. Und selbst in seiner einzigen eindeutig auf das „Risorgimento“ bezogenen Oper „La battaglia di Legnano“ legte er den Akzent nicht auf politische Konflikte im eigentlichen Sinn. Wie später in seinen erfolgreichsten Opern geht es um Machtkämpfe zwischen Individuen: zwischen Mann und Frau (in „La Traviata“), zwischen einem von seiner Arbeit korrumpierten Angestellten und seinem gewissenlosen Patron (in „Rigoletto“), zwischen einem Emporkömmling und den alten Eliten (in „Simon Boccanegra“ und „La forza del destino“), zwischen einem Geächteten und dem Establishment (in „Il trovatore“).
Weltliteratur
Nach dem triumphalen Erfolg seiner „Aida“ macht Verdi seinen bereits wiederholt angekündigten Rückzug von der Opernbühne wahr. Außer der „Messa da Requiem“ und dem extravaganten Streichquartett komponiert er in den 1870er-Jahren so gut wie nichts. Im Jahrzehnt darauf begreift er jedoch, dass „Aida“ angesichts des inzwischen weltweiten Wagner-Enthusiasmus nicht sein letztes Wort sein kann, wenn er dem rapiden Prestige-Verlust der italienischen Oper entgegensteuern will. Nun orientiert er sich tatsächlich an Wagner, allerdings nicht an dessen dramaturgischen Ideen oder an dessen Musik, sieht man einmal von augenzwinkernd-ironischen Anspielungen in „Otello“ und „Falstaff“ ab, die für die Substanz der Werke ohne Belang sind. Nein, er reklamiert wie Wagner für das Musiktheater einen Platz im Parnass der Hochkultur. Wie es Beethoven bereits für die Instrumentalmusik eingefordert hatte, soll nun auch die italienische Oper zum autonomen, unantastbaren Kunstwerk überhöht werden.
Im Gegensatz zu Wagner setzt er diese Nobilitierung einer Gattung, die immer noch mit oberflächlichem Amusement assoziiert wird, aber nicht mit Propagandaschriften, durch, sondern mit dem Bezug auf nationale und internationale Literatur von höchstem Rang. Shakespeare wird zum Fixpunkt seines dramaturgischen Denkens, sowohl „Otello“ als auch „Falstaff“ beziehen sich auf Dramen des herausragenden englischen Dramatikers. In der Detailgestaltung seiner beiden letzten Opern und des 1881 überarbeiteten „Simon Boccanegra“ spielt er mit Verweisen auf die Gründerväter der italienischen Nationalliteratur: Dante, Petrarca und Boccaccio.
Trotz der anhaltenden Erfolge Wagners gelingt Verdi diese Emanzipation seiner Oper aus den Untiefen des Unterhaltungstheaters. Er stellt sich in eine Reihe mit den künstlerischen Vertretern einer musterhaften „italianità“ und damit nicht nur neben die genannten Schriftsteller aus dem 14. Jahrhundert, sondern auch neben einen Michelangelo und einen Raffael. Gleichzeitig bleibt er jedoch – zum Glück – Eklektiker. Denn nur die Offenheit für alle europäischen Traditionen, wie sie auch das Werk eines Händel, eines Mozart, eines Johann Sebastian Bach und eines Beethoven geprägt hatte, erlaubt ihm die ebenso eingängige wie differenziertere, die ebenso prägnante wie zeitlose Ausformulierung menschlicher Leidenschaften und sozialer Konflikte in Musik, wie sie nicht erst seine späten Meisterwerke auszeichnen.