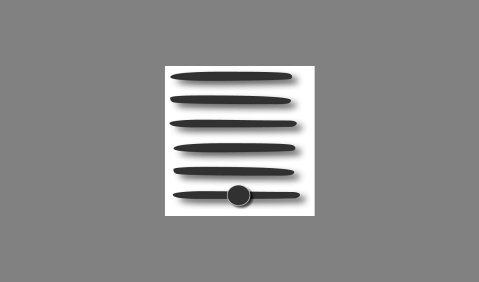Wie würde wohl John Cage, der für seine Abrechnung mit der abendländischen Opernliteratur in „Europeras 3“ sechs ständig parallel Vinyl auflegende Platten-Spieler verlangt, auf die CD-Kultur und auf deren nun oft prognostiziertes Ende reagiert haben? Bei „Europeras 4“ im Rahmen des Festivals „Infektion!“ an der Staatsoper Berlin erfolgt die behutsame Aktualisierung: der Pianist spielt seine Noten vom iPad, und der Bariton holt sich seine Lauf-Infos vom Cellphone.
Eine englische Aufschrift auf der Seitenwand der nicht völlig von Stockhausens „Originale“ umgebauten Werkstatt im Schillertheater verkündet als Botschaft (auf Englisch): „Zielstrebig trennen wir Dinge vom Leben (vom Austausch), aber jeder Augenblick kann plötzlich Zerstörung bringen, und was dann passiert, ist frischer“ (Übers. d. Verf.). Cage hat seine theatral-mathematische Vorgehensweise begründet durch den Ausspruch, „200 Jahre lang haben uns die Europäer ihre Opern geschickt. Nun schicke ich sie alle zurück!“. Antiquiert wirkt die geordnete Aleatorik des 1992 verstorbenen Komponisten heute durch die Tatsache, dass die Opernzitate, die sieben Sänger gleichzeitig vortragen, ungestützt von zwei Klavieren und sechs gleichzeitigen Schallplatten-Zitaten, am Ende des 19. Jahrhunderts halt machen – zumal zum Zeitpunkt der Komposition die nachfolgenden Opern des 20. Jahrhunderts noch geschützt und insbesondere nicht tantiemenfrei waren.
So freuten sich denn die in der dritten Aufführung handverlesenen Opernfreunde, welche Arien sie welchen Opern zuordnen konnten und welche berühmte Sängerstimmen sie darüber hinaus von der Schallplatte wiederzuerkennen vermochten.
Europeras 3
Die digitalen Uhren, die anstelle eines Dirigenten, fürs Publikum sichtbar, den Zeitablauf der 90 Minuten von „Europeras 1“ bestimmten, gelten auch für die 70 Minuten von „Europeras 3“ und die 30 Minuten von „Europeras 4“. Auch in diesen Spielvorlagen hat Cage nach dem Zufallsprinzip des chinesischen „I Ging“ Dauer und Tempo der Arien ebenso präzise festgelegt, wie die Wege der Darsteller im Raum auf 64 quadratischen Feldern – die hier sehr bunt sind, allerdings von dem mit auf der Spielfläche sitzenden Publikum kaum als strukturelle Ordnung wahrgenommen werden können (Bühnenbild: Bühnenbild: Corinna Gassauer).
Regisseurin Sophias Simitzis hat sich kaum etwas darüber Hinausgehendes einfallen lassen: drei Kleindarsteller sitzen als Publikum auf der Empore und verfolgen den bisweilen durch Strobo-Blitze gestörten Ablauf mit Opernguckern. Auf goldenen Kothurnen wandelt der goldgeschminkte, weiß gekleidete lyrische Bariton Manos Kia einher und hält sich wiederholt eine LP vors Gesicht. Sopranistin Esther Lee bespielt ihre Schuhe als Telefonhörer, ihr schwarzer Pumuckel-Kopfputz ist ein Zitat aus Achim Freyers „Zauberflöten“-Inszenierung, wie auch ihre fleckige Schminke den gestaltenden Meister verrät.
Mindestens sechs Arien darf jeder der sieben Solisten in der Berliner Produktion von „Europeras 3“ komplett singen, und wer kein absolutes Gehör besitzt, nimmt vor seinem Einsatz die Stimmgabel oder ein Tonpfeifchen zu Hilfe. So steuert der Bassist Markus Hollop die komplette Ansprache des Hunding aus dem ersten Akt der „Walküre“ bei, der lyrische Tenor Torsten Süring die Erzählung Loges und dann auch Mimes Erklärung aus dem zweiten Akt des „Siegfried“, und von den Klavieren wird immer wieder „Tannhäuser“, „Parsifal“ und die Spinnstube aus dem „Fliegenden Holländer“ angespielt. Von den Schallplatten, welche von den Dramaturgen der Staatsoper aufgelegt werden, erklingt auch mal Selteneres aus dem Opernrepertoire, wie Schuberts „Alfonso und Estrella“ und Mascagnis „L’Amico Fritz“.
Europeras 4
Vermutlich wäre es fürs Publikum hilfreich gewesen, die einfacher strukturierte „Europeras 4“ an den Anfang des Abends zu stellen. Nach der Pause bietet die halbstündige Aufführung von Cages letzter „Europeras“ in der Reduzierung allerdings eine Steigerung. Günther Albers, im roten Hemd, mit Sonnenbrille und Goldkettchen, liefert am Flügel zunächst nur einige wenige Störtöne, während in Isabel Ostermanns Inszenierung die Sopranistin Carola Höhne bei Elisabeths Hallenarie zur Textzeile „zog aus dir“ beginnt, sich selbst auszuziehen. Überlagert werden die kompletten Szenen, Sieglindes Erzählung, Euryanthes Arie aus Webers Oper, mit Mozart-Arien des Baritons Arttu Kataja, der aber auch Wolframs Lied an den Abendstern interpretiert. Mehr und mehr überlagert eine Klavierparaphrase der Fieberfantasien des todwunden Tristan aus dem 3. Aufzug „Tristan und Isolde“ den Gesang, zu dem – aus dem Off – auch Laurettas Arie aus Puccinis „Gianni Schicchi“ gehört.
Der eigentliche Witz dieser Aufführung aber liegt im Einsatz eines Trichtergrammophons, das Marilyn Barnett auch während des Abspielens der 78er-Schellackplatten erneut aufziehen muss, in den bizarr veränderten Tonhöhen der Aufnahmen aus „La Bohéme“ und „Zar und Zimmermann“ und schließlich mit einem heutigen DJ-Verfahren: die Platten-Spielerin scratcht die Koloraturen aus „Die Entführung aus dem Serail“, schafft neutönerisch anmutende Verdopplungen und Verlängerungen, bis sich das von den projizierten Digitaluhren mit „30:00“ angegebene Ende der Oper exakt deckt mit Konstanzes letztem „zuletzt befreit mich doch der Tod“.
Nach beiden Anti-Opern des amerikanischen Komponisten und Initiators der „Fluxus“-Bewegung dankte das hart gesottene Insider-Publikum dieser „spektakulären Neuauflage“ (so die Ankündigung der Staatsoper). Sie bietet Opernfreunden, insbesondere von Mozart und Wager, eine Ballung von Lieblingsarien, wie sie sonst in so kurzem Zeitrahmen nirgendwo zu erleben sind.
- Weitere Aufführung: 19. 6. 2015