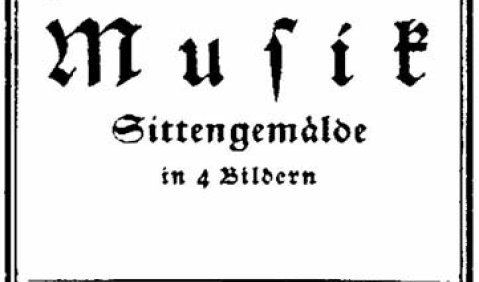Eine Kölner Musiktheaterproduktion, der man eines nicht vorhalten kann, dass sie es nämlich hätte an Mut fehlen lassen. Sicher, den Ausflug einer, wie es so schön heißt: umstrittenen Autorin ins Opernfach, hätte es ohne den Geburtshelfer, ohne den Bündnispartner Fonds Experimentelles Musiktheater in dieser Form mit Sicherheit nicht gegeben.
Nicht so, wie wir ihn jetzt erlebt haben. Als großen Theaterabend mit großem Orchester, mit Tanz, Schauspiel, Video. Und einer Leerstelle namens Musik. Was man, um der Sache auf die Schliche zu kommen, respektive, um ihr doch gewiss auch ihre positive Seite abzulauschen, nur ein wenig umformulieren muss, indem man nämlich sagt: und einer Projektionsfläche namens Musik. Denn das ist sie für Helene Hegemann und ihre Dramaturgin Janine Ortiz in jedem Fall. So wie 21jährige Erfolgsautorin in ihrem mittlerweile zweiten Roman gegen die seelenlose „Kultur- und Kunstschickeria“ zu Felde zieht, so artikuliert auch „Musik“ das Verlangen (im Tonfall dieser neoexpressionistischen Hegemann-Inszenierung): den Schrei nach dem „echten Leben“. Die Welt ist schlecht, nur mein Gefühl, das belügt mich nicht.
Emotion muss körperlich werden
Als zur „Übermalung“ frei gegebener Steinbruch diente das Drama „Musik“, Frank Wedekinds 1908 uraufgeführtes „Sittengemälde“ einer Dreiecksgeschichte um zwei Frauen, einen Mann. Letzterer heißt Josef, ist Gesangspädagoge und wird von Hegemanns Libretto dazu verdonnert, den rüden Wüstling zu geben, was Bariton Henryk Böhm zwischen seinen Gesangseinlagen routiniert abspielt: das bekannte Unwesen Mann. Anmerkung: Für eine gewiefte Romanautorin vielleicht doch etwas zu eindimensional, gefühlt jedenfalls. Umso besser kommen die beiden Frauen weg. Da ist Klara, die der Musik ehrlich hingegebene junge Sängerin. Eine Karriere stellt sich im Stück zwar nicht ein, dafür aber zwei Schwangerschaften, eine Abtreibung, eine Totgeburt, ein Psychiatrieaufenthalt. Und da ist Else, die zwischen Zynismus und Solidarität und Glückssuche taumelnde Ehefrau des Mittelklasse-Monsters Josef.
Was die Kölner Besetzung der Frauenfiguren angeht, so war sie für Hegemanns dialektisch-versteckte Liebeserklärung an die Oper – die Emotionalität der Oper in der Antihaltung gegen die Oper suchen – ein wahrer Glücksfall. So seltsam unberührt die Inszenierung als Ganze lässt, das frische, das auftrumpfende Spiel von Judith Rosmair als Else, von Gloria Rehm als Klara, holte die Kastanien aus dem Feuer, indem die von der Dramaturgie beschworene „Intensität der Emotion“ körperliche Gestalt annahm. Wobei Michael Langemann seiner Sopranistin Gloria Rehm, ausgestattet mit einer für eine Sängerin bemerkenswerten darstellerischen Kompetenz, noch die eine und andere „Wahnsinnsarie“ zugemutet hatte. Der Forderungsgrad insgesamt also hoch. Aber, es wurde zum Plus dieses Abends, die Darsteller waren bereit, zu liefern. Kurz, zu erleben war eine überzeugende Kölner Ensembleleistung bis in die Nebenpartien mit John Heuzenroeder, Lucas Singer und vor allem mit Dalia Schaechter als Klaras Mutter. Man spürte sie nicht mehr – die unendliche Arbeit in diesem ganzen Spiel um Härte, um schonungslosen Umgang mit sich selbst und mit meinem Feind in meinem Nächsten.
Was man andererseits auch spürte, war ein Hinterherhinken der Musik in „Musik“. Michael Langemann, Schüler von Manfred Trojahn, George Benjamin, Tristan Murail, ist ein versierter Komponist, der alle Register ziehen kann. Sein Orchestersatz kann geräuschvoll schnurren, kann poppige Schlagzeug-Rhythmen und E-Gitarren als Teppich weben für diverse Schnulzen und er kann, meistenteils jedenfalls, den Fundus spätromantischer Orchesterklänge plündern. Was uns auf die schöne, im Programmheft mitgeteilte Anekdote von Wedekinds Frack bringt. Das historische, real existierende Josef-Vorbild hatte ihn sich nämlich von Wedekinds Witwe erbeten und auch bekommen. So in etwa verhält sich das mit Langemanns „Musik“. Sie läuft ständig im Frack von anderen herum. Aber wie anders sollten extreme Gefühlslagen wie die eines Hegemann’schen Librettos heute auch originär Musik werden können? Es ist ein Krisenphänomen, auf das uns diese Produktion noch einmal nachdrücklich aufmerksam macht.
Theater muss Film werden
Krise hin. Krise her. – Helene Hegemann hat sich darum in ihrer Regie nicht groß geschert. Vielmehr hat sie, was vom Kölner Gürzenich-Orchester unter Walter Kobéra aus dem Circle im Kölner Palladium kam, konsequent als Material benutzt, um zu illustrieren, mit Dancefloor-Einlagen zusätzlich zu dekorieren. Die Rollen von Koch und Kellner klar verteilt. Immer wieder schob sich denn auch abwechselnd transparente Gaze und opake Leinwand vor den Betrachter, womit wir, short cut, im Kino waren und Klara und Else dabei zu gucken konnten, wie sie draußen vor dem Palladium im Kölner Straßenmilieu herumlaufen, telefonieren, busfahren oder einfach nur da stehen. Auch das gehörte zur Härte, sprich: zur künstlerischen Konsequenz von Hegemann/Ortiz, Langemann/Wedekinds „Musik“-Theater als „Musik“-Movie zu deuten. Der Film durchaus so etwas wie der Garant für das dieser Produktion eingeschriebene Verlangen nach dem „Echten“. Dazu passte nicht zuletzt die zittrige Handkamera von Kathrin Krottentaler, einer langjährigen Mitarbeiterin von Christoph Schlingensief. Womit zum Schluss auch noch diese Brücke zum Magier einer radikalen Kunst für ein besseres Leben geschlagen ward. Im Abspann war dieses Kölner Musiktheater dann ganz unter der Decke des großen Kinofilms gekrochen. Über flackerndem Grund liefen die Namen. Und schon vorher hatte Klara, wie in der Zeitoper der Hindemiths, der Kreneks, auf der Fernbedienung shutdown gedrückt.
Weitere Vorstellungen: 11., 14., 19., 22.12.