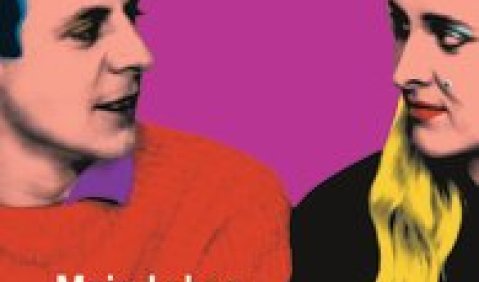Auch wenn es nicht so wirken mag, sie kennt doch eine innere Form von Ruhe. Dann dient ihr die Musik als Genussmittel im Verborgenen. Wenn’s draußen regnet, ist etwa Leoš Janačék ein willkommener Gast: „Auf verwachsenem Pfade“, herrlich melancholische Klaviermusik, gespeist aus mährischen Volksklängen. Morgens, wenn Heidenreich ihre Küche betritt, stellt sie meist als erstes das Radio an: Musik – was sonst? Doch dazu braucht sie keine semiwissenschaftlichen Erklärungsversuche, keine Ausführungen zu Kontrapunkt oder Reprise. Nein, Musikmoderationen im Radio sollen Lust auf Mehr wecken, nicht mehr und nicht weniger.
Die Idee, ihre beiden großen Liebschaften – Musik und Literatur – miteinander zu verbinden, hat wohl schon länger in ihr geschlummert. Inzwischen ist sie Herausgeberin einer nach ihr benannten Reihe: „Edition Elke Heidenreich“. Pro Halbjahr erscheinen vier, fünf Bände – in ihrer Summe eine bislang singuläre Buchreihe über unterschiedliche Umgangsformen mit dem Thema Musik. Den Auftakt machten ein Bestseller vergangener Tage, der zu Unrecht vernachlässigte „Verdi“-Roman von Franz Werfel, außerdem ein Roman-Frischling von Günther Freitag, „Brendels Fantasie“, sowie ein Essay-Band mit Schriften des Opernregisseurs Hans Neuenfels. In weiteren Etappen wurden der Weg des Liedes von „Lili Marlen“ nachgezeichnet und das Innenleben des von Daniel Barenboim gegründeten „West-Eastern Divan Orchestra“ beleuchtet. Romanhaft hat Chris Greenhalgh die historisch verbürgte Liebesgeschichte zwischen Coco Chanel und Igor Strawinsky gedeutet. In einem Sammelband haben Prominente ihre Liebesbekundungen zur Musik in Worte gefasst. Auch Helmut Krausser konnte gewonnen werden: für ein Buch über Giacomo Puccini und seinen vergessenen Widersacher Alberto Franchetti, und Tim Blanning hat in seinen Streifzügen durch die Musikgeschichte erklärt, warum sich das Ansehen von Musikern über die Jahrhunderte immer wieder gewandelt hat.
Diese Edition ist für Elke Heidenreich nicht nur Herzenssache, sondern auch das Ergebnis logistischer Präzision. Denn die Suche nach geeigneten Titeln erstreckt sich nicht nur auf den deutschsprachigen Raum. Es wird weltweit gefahndet. Zunächst anhand von Listen, in einem zweiten Schritt werden Exposés ausgewertet, die meist vorab übersetzt werden müssen; schließlich muss die Mischung stimmen. Naheliegendes und Entlegenes, Komisches und Ernsthaftes, Groteskes und Poetisches – alles will berücksichtigt werden. Von daher verwundert es nicht, wenn Horacio Salas uns den Mythos Tango erklärt, unterstützt durch Illustrationen des argentinischen Zeichners Lato, und die indischstämmige Lee Langley die Fortsetzungs-Geschichte zu „Madame Butterfly“ liefert. Wer meint, die Musikkritik sei ein langweiliges Gewerbe, dem seien dringlich Edward W. Said und sein Band „Musik ohne Grenzen“ ans Herz gelegt; nach der Lektüre dieses Buches erscheint ein vermeintlich in die Jahre gekommenes Genre auf einmal wieder hell und frisch.
Hans Neuenfels hat mittlerweile einen zweiten Band der Edition zugeführt. Diesmal erzählt er Stationen aus seinem Leben – ein Buch, so kühn, so sprachlich anspruchsvoll, so inhaltlich erhellend, dass man hier den Begriff „Autobiographie“ mit Recht und in voller Ernsthaftigkeit ins Feld führen darf. Neuenfels erzählt seinen Werdegang vom gefühlten „Bastard“-Dasein, über seine fromme Jüngerschaft von Max Ernst und die ersten Schauspielengagements bis zu seinen Opern-Arbeiten, die 1974 mit Verdi in Nürnberg einsetzten und im vergangenen Jahr mit Wagners „Lohengrin“ in Bayreuth vorläufig endeten. Doch wer Neuenfels kennt, weiß, dass er die nächsten Bühnen-Projekte schon in seinem Kopf trägt.
Großartig ist Olivier Bellamys Martha-Argerich-Biographe zu nennen. Dieses Buch kommt erfrischend anders als viele Musikerbiographien daher, die oft mit Dokumenten, Zeitungskritiken und Daten überladen sind. Hier wird das Leben dieser sphinxhaften Pianistin, halb Phantom, halb Phänomen, auf spannende und unterhaltende, kurzweilige, schockierende und berührende Weise erzählt. Es geht nicht um Analysen ihres Klavierspiels. Die ergeben sich, indirekt, aus der Beschreibung ihres Lebens. Am Ende hat der Leser das Gefühl, der Unnahbaren ein Stück näher gekommen zu sein.
Herbert Rosendorfer hat mit „Der Meister“ einen Roman vorgelegt, der verwegen komisch ist und die Musikwissenschaft auf rosendorferisch herzliche Weise entlarvt und enttarnt. Der Hirnfroscher Daniel J. Levitin zeigt, dass neben der Sprache auch unser Musikempfinden den Menschen zu einer einzigartigen Spezies auf diesem Planeten macht. „Songs“, wie er es pauschal nennt, geben den Menschen Trost, wecken Hoffnung, und bringen sie in ihrer Religiosität zusammen. Levitin liefert eine spannende Spurenlese von Erkenntnissen und Gedanken, wie Musik das menschliche Leben (mit-)bestimmt. Zuletzt erschienen sind Mary Bauermeisters Erinnerungen an ihr Leben neben Karlheinz Stockhausen. Man hat es immer geahnt, teils auch gewusst, aber hier bekommt man es sozusagen beglaubigt: Stockhausens Welt ist eine eigene. Sie ist skurril, explosiv und kreativ.
25 Bände umfasst die „Edition Elke Heidenreich“ inzwischen; weitere werden in regelmäßigen Abständen folgen.
Zuletzt unter anderem erschienen in der „Edition Elke Heidenreich“, Random House/C. Bertelsmann:
Mary Bauermeister: Ich hänge im Triolengitter. Mein Leben mit Karlheinz Stockhausen, 336 S., Abb., € 21,99, ISBN 978-3-570-58024-0
Daniel Levitin: Die Welt in sechs Songs. Warum Musik uns zum Menschen macht, 336 S., € 21,99, ISBN 978-3-570-58020-2
Hans Neuenfels: Das Bastardbuch. Autobiografische Stationen, 512 S., Abb., € 21,99, ISBN 978-3-570-58028-8