Peter Wicke: Rammstein. Provokation als Gesamtkunstwerk, Hannibal Verlag, Innsbruck 2024, 239 S., Abb.,€ 25,00, ISBN 978-3-85445-783-1
Gesamtkunstwerk mit Pimmel
Skandale, Tabubrüche, Provokationen am laufenden Band. Verfolgt man einschlägige Medienberichte oder nimmt das neue Buch des emeritierten Professors Peter Wicke zur Hand, könnte man meinen, die Kulturwelt dreht sich um Rammstein. Tatsächlich interessiert sich nur ein Teil des popaffinen Publikums für das „kulturelle Phänomen“, wie Wicke die Band beschreibt. Mit großer Wahrscheinlichkeit interessieren sich weit mehr Menschen in Deutschland und der Welt für Schlager, Kunstausstellungen, Theater oder andere Popangebote.
Dennoch ist es natürlich richtig, dass die ostdeutschen Rocker mit ihrer Musik, den Shows und oft zweideutigen Texten im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wenn wieder ein neues Album erscheint. Weit mehr Aufmerksamkeit erzielten sie allerdings vor mehr als einem Jahr durch die Causa Lindemann, die eine heftige Debatte entfachte. Der Sänger der Band, Till Lindemann, war von mehreren Frauen des sexuellen Machtmissbrauchs und der Anwendung von Gewalt beschuldigt worden.
Ausgelöst wurden diese Vorwürfe durch einen irischen Fan, die nach dem Konzert in Vilnius Strafanzeige gegen unbekannt gestellt hatte. Nach dem Medienhype, den diese Nachricht auslöste, meldeten sich weitere Frauen und berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Die Ermittlungen wurden später eingestellt. Gerichtliche Verfügungen Lindemanns gegen mehrere Medien waren teils erfolgreich.
Wie geht nun der Musikwissenschaftler Wicke, ein ausgewiesener Experte der Popularmusik, mit diesen Vorwürfen um? Flapsig ausgedrückt: er wischt sie beiseite. Auf mehreren Seiten beschäftigt er sich mit dem Thema, sieht darin eine „beispiellose Medienkampagne“, eine „skandalsüchtige Voreingenommenheit“ und verweist auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die nichts ergeben haben. Und er zitiert Bandmitglieder Lindemanns, die ihm den Rücken stärken und das „Zusammenstehen“ betonen. An einer Stelle weist Wicke auf die Rolle Lindemanns als liebevoller, alleinerziehender Vater hin, ein Framing, das er vorher bei anderen Medien ausdrücklich und entschieden anprangert. Die Absicht dahinter, dass ein solcher Mensch keiner Fliege, um es sarkastisch zu überspitzen, beziehungsweise keiner Frau etwas zuleide tun könne, entspricht der simplen populistischen Naivität eines unbedingten Fans. Eines Wissenschaftlers ist eine derartige Gleichsetzung nicht würdig. Genauso billig ist die Erklärung, die viel zitierte „Row Zero“, die es bei allen größeren Popevents gibt, mit dem Sturm weiblicher Fans auf Frank Sinatra zu begründen.
Wicke wettert gegen die „selbsternannten Statthalter des Heiligen Grals der woken cancel culture“, die er generell gegen Kritiker und Gegner der Band ins Feld führt. Auch das eine ziemlich billige Tour. Zu billig, um Eltern und Müttern eine Klatsche zu verpassen, die ihre Jungs vom übertriebenen Männlichkeits- und Machogehabe der Band fernhalten wollen. Denn natürlich ist das Spiel mit der Doppeldeutigkeit und die Lust an der Provokation, die Wicke seitenlang ausführt, kontextualisiert und bewundert, auch ein Griff ins Klo. Wenn ich darin wühle, wie es die Band mit vielen Themen tut, muss ich mich nicht wundern, wenn auch Menschen „Bäh“ sagen. Noch weniger sollte verwundern, dass es viele Fans und kleine und große Jungs gibt, denen die versteckten oder auch offenen Mehrdeutigkeiten und ironischen Verweise sonstwo vorbeigehen, wenn sie „Deutschland, Deutschland“ oder andere Refrains bis zur Heiserkeit mitgrölen.
Das bedeutet im Umkehrschluss keineswegs, dass (Pop-)Musiker, Texter und andere Künstler auf jegliche Ironie und Zuspitzung verzichten und nur eindeutig verständliche Kunst produzieren sollten. Kunst lebt von Vieldeutigkeit und Vielfalt. Unabdingbar aber ist das Bewusstsein darüber – bei Rammstein vorhanden – und das Eingeständnis, dass keineswegs alle Fans, wie es Wicke beschreibt, diese Vielschichtigkeiten auch zu deuten wissen oder deuten wollen. Es ist sogar davon auszugehen, dass das einem erheblichen Teil der Anhängerschaft schlicht schnuppe, piepegal, einfach wurscht ist. Gerade jüngere, aber keineswegs nur solche Männer geilen sich auch am Machogehabe und der Gigantomanie – der auch Wicke verfallen scheint – von Rammstein-Shows lustvoll auf. Das dürfen sie auch und die Band darf weiterhin mit solchen Attributen, Zitaten und Versatzstücken spielen.
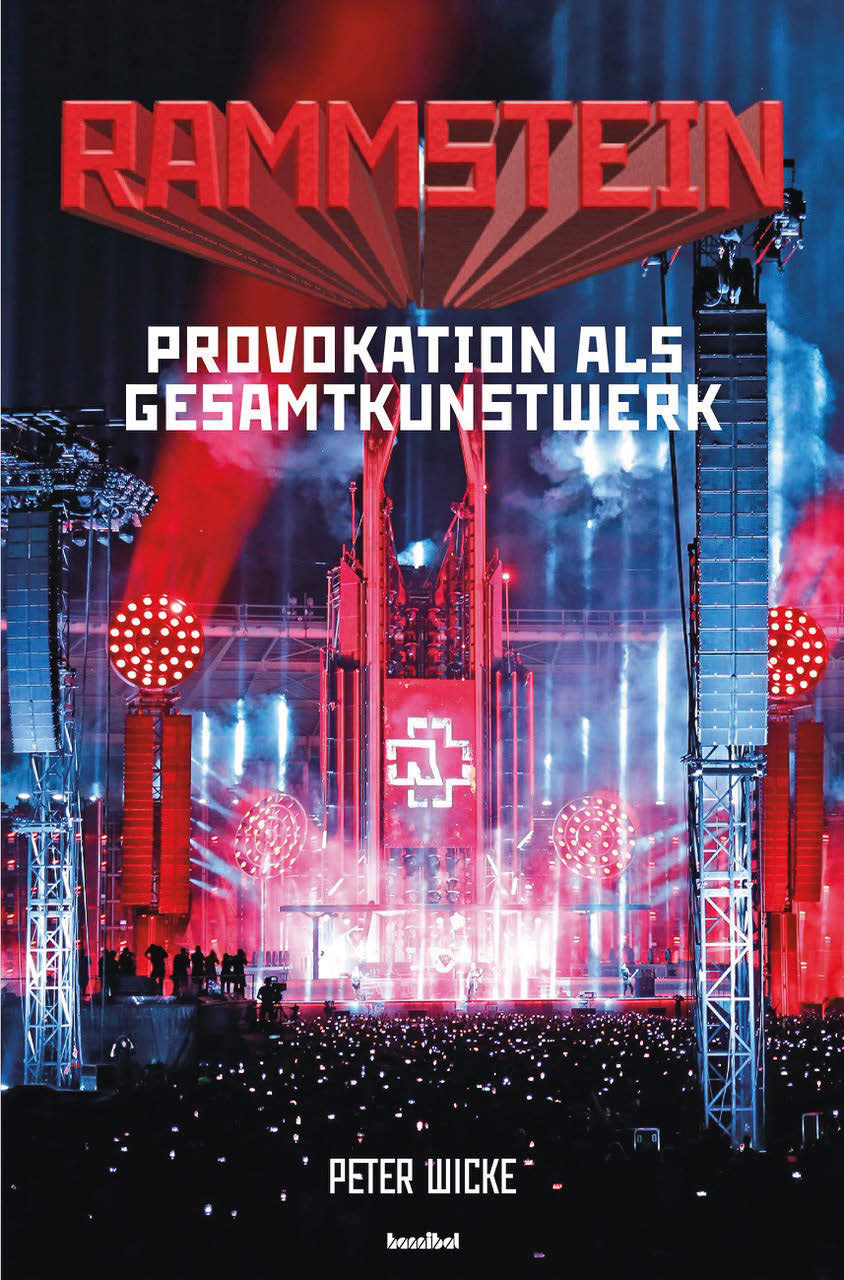
Peter Wicke: Rammstein. Provokation als Gesamtkunstwerk, Hannibal Verlag
Sie mit den pubertären Riesenpimmeln und anderen derben Showelementen auf der Bühne in den Popolymp zu verfrachten und als sakrosankt zu erklären, ist allerdings dürftig. Zudem ist die genaue Aufzählung und Auflistung von Instrumenten, Bühnenaufbauten, Anzahl der Trucks und des Stromverbrauchs – von Energieersparnissen ist nirgends in der Rehabilitationsschrift die Rede – etwas für Nerds und angehende Bühnentechniker oder -ingenieurinnen. Als Entlastung und Reinwaschung von Vorwürfen, wie sie Lindemann hat ertragen müssen, reicht diese Rammstein-Eloge nicht.
Das Mindeste, was Lesende hätten erwarten können, wäre eine persönliche Stellungnahme des Sängers im Rahmen eines Interviews beispielsweise. Empathie für betroffene Frauen und eine Auseinandersetzung mit dem Machtgefälle zwischen großmannssüchtigen Stars und Fans wären ein echter Gewinn. Ohne diese Sachen liest sich das Buch, das auf einem erweiterten Text von 2018 basiert, eher wie der ausgefeilte Werbetext eines Fans, der ähnlich tickt wie sein Objekt und Nichtgleichtickenden höhnisch entgegenschleudern kann, „ihr seid zu doof, uns zu verstehen“.
- Share by mail
Share on