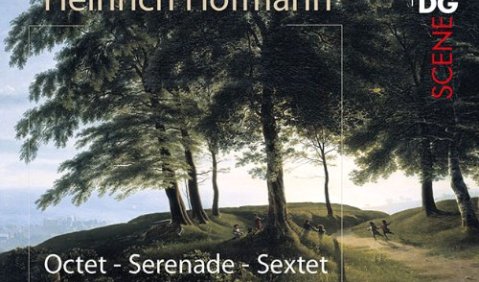Diese beiden im hochauflösenden 2+2+2-Verfahren eingespielten Kammermusik-Programme drängen sich für eine Rezension Seite an Seite geradezu auf, nicht nur, weil das erst 2009 gegründete Berolina-Ensemble sie in nur halbjährlichem Abstand voneinander veröffentlicht hat, sondern sie auch zwei vollkommen vergessene Tonsetzer der Kaiserzeit in Erinnerung rufen, die hier mit „Oktett“ und „Serenade“ überdies zwei Werktitel gemeinsam haben (allerdings ohne die gleichen Besetzungen zu verwenden).
Das Oktett des gebürtigen Berliners Heinrich Hofmann (1842–1902) war seine letzte kammermusikalische Arbeit. Es weist die ungewöhnliche Kombination von Flöte, Klarinette, Horn, Fagott und Streichquartett auf, man könnte also sagen, dass es zwar mit Schuberts Oktett F-Dur die Tonart teilt, aber dessen Kontrabass durch eine Flöte ersetzt, also ein dem gegenüber aufgehelltes Klangbild aufweist.
Da Hofmann darüber hinaus mit einer halben Stunde weniger Spieldauer auskommt, haben wir es mit einem deutlich leichtgewichtigeren Werk zu tun, das bei aller Qualität durch eine Melodienseligkeit besticht, die sich erwartungsgemäß auch in der Serenade fortsetzt, wo das Streichquartett durch Flöte und Kontrabass flankiert wird. Das wie einige Divertimenti Mozarts in D-Dur stehende Werk – ein Kompositionsauftrag des New York Philharmonic Club – mutet streckenweise wie ein Konzert für Flöte und Streicher an (es existiert in der Tat auch eine Version mit Streichorchester), was dem Unterhaltungswert natürlich keinerlei Abbruch tut.
Das Sextett für doppeltes Streichtrio von 1874, wie die beiden anderen Kostproben aus Hofmanns Werkkatalog viersätzig, ist das früheste Stück auf der Platte und das einzige, das in einer Molltonart (e) steht, was hervorragend zu dessen eher lyrischer Anlage passt.
Zusammenfassend entpuppt sich der seinerzeit viel gespielte Zeitgenosse Dvořáks und Griegs (mit Erfolgsstücken wie der „Ungarischen Suite“, der Symphonie „Frithjof“ und dem „Märchen von der schönen Melusine“) als lupenreiner Klassizist und damit als ein gegenüber Weber und Spohr um ein gutes halbes Jahrhundert zu spät Geborener, was sein blitzartiges Vergessenwerden nach der Jahrhundertwende leicht erklärt. Den Hörern leicht ins Ohr gehende, für die Interpreten dankbare Musik hat Hofmann allemal hinterlassen.
Auch die Spieldauer der anderen, ebenfalls in der Abtei Marienmünster eingespielten SACD wurde hervorragend ausgenützt. Das offenbar ungedruckt gebliebene Oktett des eine Generation jüngeren Waldemar Edler von Bausznern (1866–1931; das „sz“ stand wohl für ein „ß“) erstreckt sich allein über eine reichliche Dreiviertelstunde. Der ebenfalls in Berlin zur Welt gekommene, aber in Hermannstadt (Sibiu) und Budapest aufgewachsene Siebenbürger Sachse hat dafür ein Klavier, drei Geigen, Flöte, Klarinette, Cello und Kontrabass aufgeboten und dem in einer (allzu) ausufernden Variationenfolge kulminierendem Fünfsätzer immer wieder eine quasi orchestrale Klangfülle ermöglicht.
Zuvor sind wir schon durch die Weiten der Puszta gezogen, haben erst einen Csardas, dann einen Wienerischen Ländler getanzt und schließlich einer Ungarischen Trauermusik für Klavier solo gelauscht, sind also gleichsam zu den frühen Stätten der musikalischen Autobiographie von Bausznerns gepilgert. Mit Siebenbürgen, dem Land seiner Kindheit, verbanden den knapp Fünfzigjährigen nur angenehme, vielleicht ein wenig idealisierte Erinnerungen. (Ungarn büßte nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Staatsgebietes ein.)
Die zweite Hälfte des Konzerts beginnt mit der einst recht beliebten Elegie für Violine und Klavier noch recht verhalten, bevor sich für die Serenade eine Klarinette hinzugesellt; sie ist keinem geringeren als Richard Mühlfeld gewidmet, dem wir die Inspiration zu Brahmsens später Kammermusik verdanken. Trotzdem verbietet sich der Vergleich zu des letzteren Klarinettentrio op. 114, schon weil dieses mit einem Cello anstelle der Geige besetzt ist. Hier jedoch agieren Geige und Klarinette, ihrem ähnlichen Tonumfang entsprechend, gleichberechtigt. Zweimal benutzt von Bausznern in den Satzbezeichnungen den Begriff der „Grazie“, die dem stämmigen Hamburger eher fern gelegen haben dürfte, aber von Bausznerns Stilideal für seine aus gutem Grund „Serenade“ überschriebene Komposition wohl insgesamt recht nahe kommt.
Von Bausznerns Musik vermittelte an sich vorbildlich zwischen den damaligen Polen der alt- und neudeutschen Schule (verkürzt gesagt: „Absolute Musik“ stand gegen programmatische Ansätze, Brahms kontra Liszt und Wagner). Damit setzte er sich allerdings zwischen alle stilistischen Stühle und konnte folglich, obgleich in seiner Berliner Studienzeit „der begabteste und fleißigste“ Schüler von Woldemar Bargiel, bei weitem nicht die Erfolge Hofmanns verbuchen. Seine Vielseitigkeit und Toleranz prädestinierten ihn aber geradezu für eine akademische Karriere. Zuletzt wirkte er als Direktor des Hoch'schen Konservatoriums in Frankfurt; seinem sozialen Engagement ist unter anderem die Einführung des verbindlichen Musikunterrichts an Gymnasien zu verdanken.
Lassen wir uns überraschen, was die zweite Folge seiner Kammermusik zu bieten hat. Der Entdecker- und Spielfreude des Berolina Ensembles können wir uns jedenfalls weiterhin unbesorgt anvertrauen.