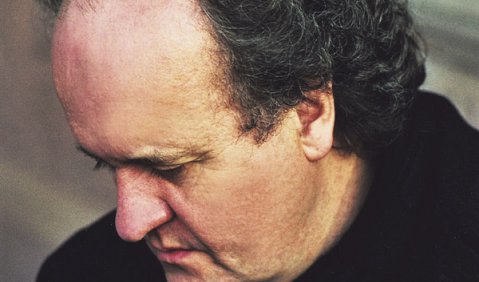In Richard Wagners „Meistersingern“ fragt der durch die nächtlichen Turbulenzen verunsicherte Ritter Walther von Stolzing den Schuster-Poeten Hans Sachs, wie er denn nun sein Meisterlied für die Festwiese anlegen müsste, um den Regeln der Zunft zu genügen: „Wie fang ich nach der Regel an?“ Darauf Sachs: „Ihr stellt sie selbst und folgt ihr dann“. Als ein noch jüngerer Komponist dem schon arrivierten Wolfgang Rihm einmal sein Leid klagte, dass ihm nichts für ein neues Werk einfalle, riet ihm dieser, er möge das doch komponieren: dass ihm nichts einfalle.
Dann würde man schon weitersehen. Noch etwas Anekdotisches: Nach der Uraufführung von Rihms Ballett „Tutuguri“ Anfang der 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts in Berlin, das einen handfesten Skandal entfesselte, kam es zu einem Dreiertreffen auf nachtdunkler Straße: Rihm redete, redete, redete, erklärte seine Absichten, sein Stück – bis ihn einer der schweigend zuhörenden Begleiter, es war kein Anderer als Luigi Nono, mit den Worten unterbrach: „Wolfgang, du brauchst eine Krise.“ Der Musikwissenschaftler Reinhold Brinkmann, damals der Dritte im Bunde, erinnerte an die Begebenheit in seiner Laudatio auf Wolfgang Rihm, als dieser anno 2003 den Siemens-Musikpreis in München empfing.
Wer Wolfgang Rihms Komponieren, sein umfassendes Werk, seine Reflexionen über Kunst und Kunstherstellung, sprich: die künstlerische Existenz, genauer kennt, wird die drei obigen Schilderungen sicher verstehen: Sie verraten alle etwas über den Komponisten Wolfgang Rihm selbst, über sein Künstlertum, seine Arbeitsweise, sein ästhetisches Credo.
Unser Mitarbeiter Arno Lücker, Musikdramaturg am Konzerthaus Berlin und Schüler des Komponisten Claus-Steffen Mahnkopf, entwickelt im untenstehenden Aufsatz dazu eine „These“, über die man im Detail sicher auch streiten, auch anderer Ansicht sein kann, was bei der Komplexität von Rihms Gesamtwerk nicht verwundern muss, im Gegenteil: die kritische Diskussion ist gerade in diesem Fall dringend erforderlich. Zum Beispiel darüber, ob Rihm der „‚einzige‘ große Künstler der Neuen Musik“ ist, nur weil er inzwischen so viele Opuszahlen erreicht hat wie einst Mozart. Der Musikkritiker Gerhard R. Koch äußerte bei einer Diskussion in Köln zu diesem Thema sogar Unbehagen. Die schon vor einigen Jahren ausgebrochenen Rihm-Feiern, sogar bei den Salzburger Festspielen, und die bevorstehenden Geburtstags-Huldigungen en masse rückten Rihm gleichsam retrospektiv in die Nähe klassisch-romantischer Komponier-Denkmäler. Wobei man doch fragen möchte, was daran eigentlich so verderblich sein könnte? Der „Neuen Musik“ kann es vielleicht nutzen, einen Komponisten in ihrer Mitte zu wissen, den auch ein breiteres Publikum als „Größe“, und sei es nur aus Respekt, zu akzeptieren bereit ist. Rihms künstlerische und intellektuelle Kompetenz verleihen ihm eine Autorität, die weithin ausstrahlt bis ins Politische und Gesellschaftliche hinein. Sein Wort hat Gewicht.
Ein Geburtstagsgruß ist nicht der Anlass für umfassende Werkbeschreibungen und ästhetische Reflexionen. Die Vielgestaltigkeit des Rihm‘schen Schaffens erforderte dazu gleichsam ein Kompendium. Es gibt aber von Rihm Werke, die wie in einem Brennglas Wesentliches bündeln. Im Mai 2005 wurde in Berlin das Denkmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. Für das Gedächtniskonzert am Vorabend in der Berliner Philharmonie komponierte Rihm eigens ein Werk: „3 Requiem-Bruchstücke“, die er mit „Memoria – Gedächtnis, Gedenken“ überschrieb. Dichte, verrätselte Verse von Nelly Sachs, in denen die Schreckenserfahrungen mit Zeichen, Bildern und Symbolen beschworen werden, und der reine Klang der menschlichen Stimme durchdringen sich in dem dreiteiligen Werk, mit dem der Komponist mit seiner Musik vielleicht (?) den Weg weist, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen könnten: indem wir die in Klang und Wort gefasste Erinnerung als lebendige Gegenwart erfahren.
In diesem hohen Sinn ist Rihms Musik immer auch „politisch“, weil sie dem Menschen dienen, ihn aufrütteln, nachdenklich stimmen und, was vielleicht am wichtigsten ist: ihn emotional ergreifen will. Rihms inneres Engagement entspringt einem großen Humanum. Stets behält er in seiner Musik den Menschen im Blick, dessen Würde, dessen Leid und Not. Nicht ohne Grund steht das Lied, steht die menschliche Stimme im Zentrum von Wolfgang Rihms Schaffen. Die Lineaments des Singens durchziehen überall sein Komponieren, in den Liedern natürlich, aber auch in den instrumentalen Genres. Das darf man nicht als fröhlich-seligen Melodienreigen verstehen. „Musik muss voller Emotion sein, die Emotion voller Komplexität“, sagte Rihm einmal in seinen frühen Jahren. Diese Verschränkungen der Begriffe prägen Wolfgang Rihms Komponieren von Anfang an bis heute.