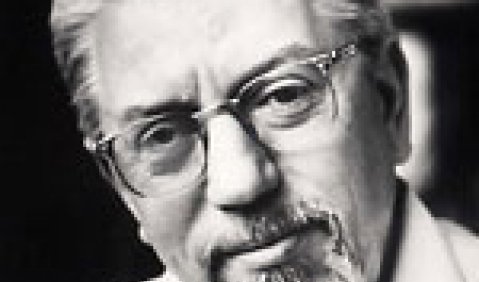Posthume Uraufführungen sind problematisch. Ihnen fehlt die durch den Autor verbürgte Gültigkeit als letzte Fassung und autorisierter Wille. Doch die Toten sind geduldig. Während Karlheinz Stockhausen seine zu Studienzeiten um 1950 entstandenen Chöre und Lieder Jahrzehnte später aus der Schublade zog, um sie Anfang der 1970er Jahre uraufführen zu lassen und auch in sein Vor-Werkverzeichnis aufzunehmen, rührte sein zehn Jahre älterer Kölner Antipode Bernd Alois Zimmermann die zwei Quartettsätze, die er während der letzten Kriegsmonate 1944/45 komponiert hatte, Zeit seines Lebens nicht mehr an. Warum nicht?
Weil dieses zweisätzige Quartett ein Torso bliebt, den zu vollenden Zimmermann nicht mehr den Ehrgeiz hatte? Weil er unter anderen Projekten die Noten aus den Augen verlor, bis sie ihm irgendwie, irgendwo abhanden kamen? Oder weil er nicht mehr zu diesem Frühwerk stand, es für überholt ansah und deswegen bewusst unterdrückte?Jede dieser Fragen mag einen Kern der Antwort enthalten, die uns der 1970 in den Freitod gegangene Komponist nicht mehr geben kann. Es bleiben indes die beiden Quartettsätze selbst, die Aufschluss genug geben, zumal aus dem Rückblick der Entwicklung, die Zimmermanns Musik schon bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs genommen hat.
Der erste Satz „Adagio molto“ ist eine konventionell dreiteilige Bogenform mit kontrastierendem, bewegtem und leicht fugiertem Mittelteil. Im Anfangs- und Schlussteil führt die erste Geige durchweg mit weit ausgesungenen Kantilenen über simpler Begleitung schwebender Moll-, Sext- und Nonakkorde. Damit entfaltet der Satz eine gewisse düstere, aber gewollt wirkende Innigkeit und Ausdruckschwere, die weniger aus seiner Faktur erwächst als vielmehr von den Spielern mit reichlich Vibrato in die Musik hinein gelegt werden muss. Die Reprise wendet das Geschehen schließlich besänftigend in versöhnliches Dur. Der zweite Satz „Allegro moderato“ fällt unter die Kategorie neoklassische Spielmusik, mit vielen Leerformeln und Sequenzenketten, die sich der spätere Polystilist in dieser Ungebrochenheit niemals gestattet hätte.
Zimmermanns einziges Streichquartett ist hörbar ein Frühwerk, und mehr noch ein erschütterndes Dokument der Unkenntnis, zu der das nationalsozialistische Unrechtsregime den damaligen Studenten verdammte. Als die Nazis die Macht ergriffen, war Zimmermann 15 Jahre alt, und als das „Tausendjährige Reich“ in Schutt und Asche lag, hatte der 27jährige seine entscheidenden Entwicklungsjahre in Diktatur und Krieg, ohne im gleichgeschalteten Blut- und Boden-Sumpf Kenntnis von den Streichquartetten Bartóks, Kreneks und der Zweiten Wiener Schule bekommen zu haben.
Aber auch in der Nachbarschaft der Meisterwerke von Haydns späten „Erdödy“-Quartetten opp. 76,1 und 6 sowie Beethovens frühem op. 18,3, alle wunderbar klar und beredt gespielt vom Hagen-Quartett in der Kölner Philharmonie, musste Zimmermanns aus der Eiskammer der Musikgeschichte posthum aufgetautes Streichquartett notwendig verblassen.