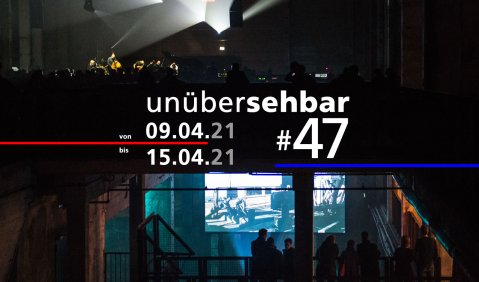Auf die Suche nach der verlorenen Nähe begibt sich die Stuttgarter Staatsoper am kommenden Sonntag. Helfen soll dabei Strauss‘ „Ariadne“, wir packen noch Saint-Exupérys „kleinen Prinzen“ als Familienkonzert, das Tonlagen-Festival und zwei Musiktheaterdoppel mit dazu. Rose pflegen nicht vergessen! [jmk]
9. bis 11. April
Staatstheater Darmstadt: „Lucrezia / Faust et Hélène“
Freitag, 9.4.2021, 19:30 Uhr; Samstag 10.4.2021, 19:30 Uhr; Sonntag, 11.4.2021, 19:30 Uhr
Live-Videostream auf der Theaterwebseite
Auch das Theater Darmstadt bleibt mit seinen Streaming-Angeboten bei seinen Zuschauern im Gedächtnis, hofft auf bessere Zeiten und produziert Neues. Am 9. April es ist ein Doppelprojekt als Online-Premiere. Die Musiktheatersparte kombiniert für „Lucrezia / Faust et Hélène“ die Händel-Kantate „Lucrezia“ HWV 145 (1706, Rom) und Lili Boulangers Kantate „Faust et Hélène“ (1913, Paris) miteinander. Den musikalischen Teil der Inszenierung von Mariame Clément leitet GMD Daniel Cohen. Die Lucrezia wird von der jungen Heidelbergerin Lena Sutor-Wernich, die Hélène von der schwedischen Mezzosopranistin Solgerd Isalv, Faust von dem koreanischen lyrischen Tenor David Lee und Méphistophélès von Julian Orlishausen bzw. Johannes Seokhoon Moon verkörpert. Alle Mitwirkenden an diesem einstündigen Programm gehören zum hauseigenen Ensemble.
Händel schrieb seine Kantate um 1706, als aufstrebender Jungstar von Anfang 20 in Rom. Er porträtiert darin die berühmte stolze Römerin, die nach einem traumatischen Erlebnis ihren eigenen Weg sucht. Für sie bedeutete das, sich lieber das Leben zu nehmen, als mit der Schande einer Vergewaltigung zu leben. Das hier als Subtext enthaltene Phänomen einer Schuldverschiebung vom Täter auf das Opfer wird in der Inszenierung erkennbar und macht einen Gutteil der Brisanz dieser Geschichte aus dem alten Rom für unsere Gegenwart aus.
Auch im zweiten Stück geht es um Gewalt gegenüber Frauen. Die französische Komponistin Lili Boulanger (1893–1918) hat für ihre Kantate für Tenor, Bariton, Mezzosopran und Orchester im 1913 ein Gedicht von Eugène Adenis als Grundlage verwendet, das auf die Begegnung Fausts mit Helena in Goethes „Faust II“ Bezug nimmt. Mit ihrer Kantate „Faust et Hélène“ gewann die jung Verstorbene 1913 als erste Frau den begehrten „Prix de Rome“.
Wer einen Blick in den Trailer riskiert, der wird neugierig auf einen spannenden Musiktheaterabend, auch wenn der bis auf weiteres nur im Kammerspielformat des heimischen Bildschirms angeboten werden kann. Nach der Vorstellung gibt es noch ein Live-Nachgespräch via Zoom mit der Regisseurin und dem Dirigenten, sowie mit Lena Sutor-Wernich und Solger Isalv.
Tickets (erm 5 /normal 10 / solidarisch 15 Euro) für die Premiere am 9. April (19.30 Uhr) – mit Online-Nachgespräch über Zoom – sowie die Folgetermine 10. und 11. April (ebenfalls jeweils 19.30 Uhr)sind online über die Theaterwebseite zu erhalten.
[Joachim Lange]
Ab 11. April
Staatsoper Stuttgart: Ariadne-Tag
Sonntag, 11.4.2021, 14:30 Uhr bis open end
Live-Videostream auf der Theaterwebseite
Das Gefühl dafür, was Nähe bedeutet, hat sich in den letzten zwölf Monaten neu geordnet. Ähnlich erging es bereits den Protagonist*innen in Richard Strauss‘ „Ariadne auf Naxos“. „Auf der Suche nach der verlorenen Nähe“ ist der Untertitel des Ariadne-Tags der Staatsoper Stuttgart. Ein Tag rund um Strauss‘ Oper und ihre Entstehungsgeschichte. Aus dem Forum am Schlosspark Ludwigsburg wird es die konzertante Version sowie Strauss‘ Orchestersuite zu Molières „Der Bürger als Edelmann“ geben. In der Pause liest Harald Schmidt Briefe zur Entstehung der Oper vom Librettisten Hugo von Hofmannsthal und von Strauss selbst. Ein Abend über Verlust und Nähe, über den Zusammenhang von Komödie und Tragödie. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, mit anderen Gästen sowie mit den Künstler*innen des Abends im virtuellen Foyer ins Gespräch zu kommen. Tagsüber gibt es bereits einen Blick hinter die Kulissen. Via Live-Führungen auf dem Instagram-Kanal (@staatsoperstuttgart) geht es in den Backstage-Bereich. Durchgehend verfügbar wird Gabriele Hintermaiers und Martin Laublins Vortrag über die Baugeschichte der Königlichen Hoftheater in Stuttgart sein. Anhand von Akten und Briefen erzählen sie anschaulich und detailliert von den Schwierigkeiten und Kuriositäten, die bei solchen Bauvorhaben entstehen.
Anmeldung: https://events-staatsoper-stuttgart.de/main_frontend.php?logincode=Ariadne
[Juana Zimmermann]
Bad Reichenhaller Philharmoniker: „Der kleine Prinz“
Sonntag, 11.4.2021, 15.30 Uhr, anschließend mindestens einen Monat lang verfügbar
Videostream live, dann on demand via YouTube, Infos auf der Orchesterwebseite
Zu dem in jüngster Zeit merklich angewachsenen Online-Angebot der Bad Reichenhaller Philharmoniker gesellt sich ab Sonntag Nachmittag ein Programm, das speziell auf Familien und Schulklassen zugeschnitten ist: eine Version des „kleinen Prinzen“ für Sprecher und Orchester von Thomas Dorsch (Musik) und Thomas Lange (Text). „Wesentliche Aussagen und Personen werden“, so die Ankündigung, „klangmalerisch umschrieben, der Pilot, der Prinz, die Rose, die Schlange und der Fuchs nachgezeichnet und mit zentralen Motiven wie dem Flug durch die Wüste, den Zugvögeln oder der Wanderung durch die Nacht zu einer Handlung verwoben, die durch lyrische musikalische Erfindungen begleitet wird.“ Es spielen die Bad Reichenhaller Philharmoniker unter Daniel Spaw, den Sprecherpart übernimmt Robert Eller.
[Juan Martin Koch]
11. April bis 2. Mai
Tonlagen – 30. Dresdner Festival für zeitgenössische Musik
Videostreams live und on demand auf der Festivalwebseite
Auch das Dresdner Tonlagen-Festival ist planerisch im COVID-19-Modus und verteilt sein Programm in stark modifizierter Form als Mix aus Livestreams, online-Diskussionen, Filmdokus, Konzert-Aufzeichnungen und verheißungsvollen Verschiebungen auf drei große Blöcke im April, November und Frühling 2022. In der Hoffnung, dass so illustre Produktionen wie die „Ø-Trilogie“ von Trond Reinholdtsen, ein neues Musiktheater von Helmut Oehring oder das Musical der Punk-Poeten PISSE dann ein anwesendes Publikum haben werden.
Dasjenige, was schon im April stattfinden bzw. präsentiert werden kann, ist dennoch vielfältig. Im hier zu annoncierenden Zeitraum geht es noch recht bedächtig los: Als programmatischer Startpunkt fungiert eine der berüchtigtsten Konzept-Musiken der Geschichte, die in quasi performativer Dauerschleife mit pandemischen Befindlichkeiten aufgeladen wird. In 433X22 werden ab dem 11. April täglich um 10:00 morgens wechselnde Akteur*innen im Festspielhaus HELLERAU John Cages 4’33’’ realisieren. Nicht das erste Mal in letzter Zeit …
Ein Schwerpunktthema des Festivals ist 2021 die Musik der ehemaligen DDR: Einleitend gibt es im Rahmen der hauseigenen Reihe Podcast from Hell den vom Dresdner Musikwissenschaftler Jakob Auenmüller unter dem Motto „Das Andere in der Musik?“ moderierten Podcast über die Problematik der Aufarbeitung ostdeutscher Kunst und Musik. Um 22 Uhr dann die Invitation to Dissapear, eine filmisch-installative Dystopie des Schweizer Künstlers Julian Charrière mit Elektro-Klängen von INLAND aka Ed Davenport, die auf südamerikanischen Palmöl-Plantagen an die Zerstörung natürlicher Ressourcen erinnern wird. Am 12.4. geht es dann ökologisch problemrelevant weiter mit der Klimawerkstatt Theater (9:00). Dort werden nicht zuletzt betriebsökologische Produktionsbedingungen kultureller Institutionen Thema sein (Infos, Programm und Anmeldung unter www.klimawerkstatt-theater.de).
Auf unüberhörbar #48 geht es dann auch musikalisch in die Vollen mit Ankündigungen zu leibhaftigen Konzerten von Ensemble Modern, Carsten Nicolai, Ensemble unitedberlin und Auditiv Vokal mit Paul Heinz Dittrich! Dranbleiben!
[Dirk Wieschollek]
Bis auf weiteres verfügbar
Alexander Dargomyzhsky: Esmeralda / Louise Bertin: La Esmeralda
Video on demand via Opera on video (Dargomyzhsky), Audio on demand via YouTube (Bertin), Teil 1 und Teil 2
Durch Selbstunterdrückung überhitzte Sexualität in repressiven kirchlichen Strukturen ist spätestens seit der Aufklärung ein wichtiges Motiv der Kulturgeschichte von christlich geprägten Gesellschaften. Der Archidiakon in Victor Hugos 1831 erschienenem historischen Roman „Notre-Dame de Paris. 1482 (Der Glöckner von Notre-Dame)“ wurde eine der bekanntesten literarischen Figuren im Konflikt zwischen einem dogmatischen Gelübde und seinem nur allzu menschlichen Begehren. Dank digitaler Kanäle ist der Vergleich zweier bedeutender, aber weithin unbekannter Veroperungen des Romans möglich. 2019 brachte die Staatliche Petersburger Kammeroper die ca. 1839 entstandene, allerdings erst 1847 in Moskau uraufgeführte Oper von Alexander Dargomyzhsky in einer historisierenden Inszenierung heraus. Dargomyzhskys Bemühen um eine expressive, melodisch durchsetzte Deklamation ist schon in diesem Frühwerk hörbar. Spannend gerät der Vergleich mit Louise Bertins Grande Opéra, die 1836 im Pariser Théâtre de l'Académie Royale de Musique mit prominenter Besetzung (Cornélie Falcon in der Titelpartie) zur Uraufführung gelangte. Victor Hugo schrieb der französischen Komponistin das Libretto, Franz Liszt fertigte den Klavierauszug an. Auch angesichts der Beliebtheit des Stoffes bleibt unverständlich, dass Bertins Oper fast 15 Jahre nach der Einspielung unter Lawrence Foster aus Montpellier noch immer nicht an einem Opernhaus im deutschsprachigen Raum herauskam.
[Roland H. Dippel]