Der Künstler strebt nach außen hin mit seiner Tätigkeit an: Geltung und Anerkennung in der Öffentlichkeit, und einen angemessenen Lebensunterhalt. Kann ihm der Rundfunk dazu verhelfen?
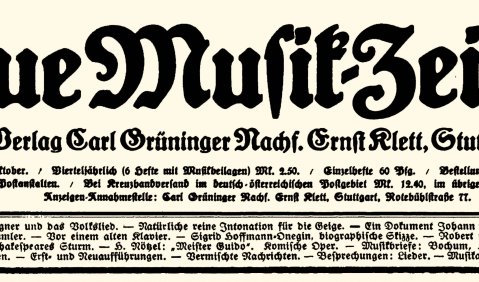
Neue Musik-Zeitung – Vor 100 Jahren
Vor 100 Jahren: Was nützt der Rundfunk dem Künstler?
Vergegenwärtigen wir uns die Entwicklung der Dinge auf diesem Gebiet. Als der Rundfunk so weit durchgearbeitet war, daß an seine industrielle Ausnutzung gedacht werden konnte, war der einschlägigen Industrie und dem Handel sofort klar, daß der, für die Wirtschaftlichkeit der Produktion erforderliche Absatz nur auf eine Weise zu erzielen war: durch die Schaffung eines noch nicht vorhandenen Bedürfnisses. Kein Mensch würde daran gedacht haben, sich eine Radio-Anlage anzuschaffen, wenn er nicht gewußt hätte, daß ihm Gelegenheit geboten sei, durch diesen Apparat etwas zu hören, wovon er sich mit mehr oder weniger Berechtigung Genuß oder Unterhaltung versprach. So wurden denn in den Vereinigten Staaten, wo der Rundfunk zuerst eine Entwicklung im großen fand, die „Broadcasting Companies“gegründet, welche ihren Abonnenten verschiedenartige Rundfunkvorführungen zugänglich machten.
Hier eröffnete sich nun für Künstler aller Art ein großes Betätigungsfeld. Diese Gesellschaften traten an zahlreiche Künstler heran mit der Aufforderung, in ihre Sendeapparate zu singen, zu spielen und zu sprechen. Als aber die Frage des Honorars angeschnitten wurde, erklärten die Gesellschaften, Honorar könnten sie nicht zahlen, denn sie würden von ihren Abonnenten ebenfalls nicht bezahlt; die Reklame, die dem Künstler durch seine Mitwirkung im Rundfunk erwachse, sei so gewaltig, daß er sich mit ihr als Bezahlung begnügen könne; würden ihm doch dadurch eigene kostspielige Konzerte erspart, die er sonst veranstalten müsse, ohne dabei die große Zahl von Zuhörern zu erzielen, die ihm der Rundfunk erreichbar mache.
In der Tat sind dadurch zahlreiche Künstler bewogen worden, sich ohne Honorar dem Rundfunk zur Verfügung zu stellen. Indessen fand der praktische Sinn der Amerikaner bald heraus, daß da etwas nicht stimmte. Zunächst fiel es auf, daß keineswegs derjenige Prozentsatz unter den noch wenig bekannten Künstlern infolge des Auftreten-s beim Rundfunk Engagements bekam, der ihn sonst infolge eigener Konzerte zu bekommen pflegte. Die Managers hatten kein Interesse daran, mit dem Engagement von Künstlern ein Risiko zu laufen, die jedermann im Radio-Apparat hören konnte. Es wurde auch bemerkt, daß die Leistung des Künstlers im Rundfunk eine Veränderung erfährt, durch welche die individuellen Züge seiner Leistung entstellt oder verwischt werden. Es stellte sich ferner heraus, daß die Konzerte bereits bekannter Künstler weniger gut besucht wurden als sonst, wenn diese sich im Rundfunk hatten hören lassen. Die „Civic Opera“ in Chicago machte den Versuch, an bestimmten Tagen der Woche die Vorstellungen durch Rundfunk zu verbreiten, und mußte die Erfahrung machen, daß der Besuch an diesen Tagen auffallend schlechter sei als an den anderen. Endlich brach sich auch die Erkenntnis Bahn, daß die Künstler, indem sie sich den Rundfunkgesellschaften gratis zur Verfügung stellten, doch nur der Radio-Industrie und dem Radio-Handel eine Reklame lieferten, die sich im Absatz der Radio-Apparate auswirkte, und daß bei, dieser Reklame jeder Beteiligte bezahlt wurde, mit Ausnahme der Künstler.
So setzte denn eine Agitation gegen diese unentgeltliche Mitwirkung ein. Sie wurde von einem Teil der amerikanischen Presse unterstützt; ja, die größte musikalische Fachzeitung Amerikas, der „Musical Courier“, übte einen Druck auf die Unbelehrbaren unter den Künstlern aus, indem er fortlaufend aus den Rundfunkprogrammen die Namen der Mitwirkenden veröffentlichte. Dadurch wurde auch in den musikalischen Berufskreisen bekannt, daß diese Künstler im Rundfunk gratis auftraten, und damit ihre Möglichkeit, für Konzertengagements gute Honorare zu erhalten, gemindert.
Das alles führte dazu, daß nunmehr die Künstler in Amerika bezahlt werden. Die Mittel dazu werden durch eine Marke aufgebracht, die auf jeden verkauften Radio-Apparat geklebt und vom Käufer bezahlt werden muß. Der Aufschlag kommt für den einzelnen Käufer kaum in Betracht. Das Publikum unterwirft sich dieser Maßnahme etwa ebenso, wie es bei uns die Sozialabgabe in den Theatern ohne Widerspruch bezahlt.
Diese Entwicklung der Dinge in Amerika ist für uns in Deutschland sehr lehrreich. Bei uns liegen die Verhältnisse insofern anders, als der Rundfunk nicht dem freien Wettbewerb überlassen, sondern ein Monopol des Staates ist. Die Reichspostverwaltung hat den Betrieb des Rundfunks neun Gesellschaften übertragen, die ihren Sitz in neun verschiedenen Städten des Reiches haben und die zum Reichsfunkverband zusammengeschlossen sind. Die Betriebsmittel dieser Gesellschaften bestehen darin, daß sie von der Reichspostverwaltung denjenigen Betrag erhalten, der von den monatlichen Zahlungen der Rundfunk-Abonnenten nach Abzug der Unkosten der Reichspostverwaltung übrig bleibt. Man darf annehmen, daß diese Überschüsse nicht sehr groß sind. Hierauf berufen sich die Rundfunk-Gesellschaften, um zu erklären, daß sie dem Künstler kein Honorar zahlen können. Sie geben ihm nur eine „Zeitentschädigung“ von durchschnittlich 50 Mk. Für dieses Honorar stellen sich tatsächlich selbst namhafte Angehörige großer Bühnen zur Verfügung.
Welchen Nutzen haben sie davon? Es lassen sich hier genau dieselben Überlegungen anstellen, die in Amerika angestellt worden sind. Der bekannte Künstler, soweit er außerhalb seiner Bühnentätigkeit Lieder- oder Vortragsabende veranstaltet, schädigt deren Besuch, und zugleich den Besuch des Theaters, an dem er wirkt und von dessen gutem Geschäftsgang seine eigene Existenz abhängt. Nicht für ihn oder für sein Theater macht sein Auftreten im Rundfunk Reklame, sondern für die Funkgesellschaft, und damit für den Rundfunk selbst, also für' die hinter den Funkgesellschaften stehenden Firmen der Radio-Industrie und des Radio-Handels. Wenn ein Künstler sich von der Bühne aus die Beliebtheit des Publikums erworben hat, so wird ein Radio-Programm Anziehungskraft haben, das den Namen dieses Künstlers enthält. Der Zuhörer am Radio-Apparat sieht den Künstler, den er von der Bühne her kennt, mit allen den Eigentümlichkeiten der Erscheinung und des Spiels vor sich, durch die ihm der Sänger oder Schauspieler lieb geworden ist; sobald er die wohlbekannte Stimme hört, ergänzt sein Gedächtnis das übrige. Nicht aber umgekehrt. Mag ein Künstler im Rundfunk seine Zuhörer noch so sehr entzücken, so wird dadurch nicht das Verlangen in ihnen entstehen, den Künstler auch auf der Bühne zu sehen, also sein Theater zu besuchen. Hier kann die Phantasie des Zuhörers nicht an etwas Reales, an den erlebten Eindruck, anknüpfen, sondern sie muß sich aus eigener Kraft eine so lebhafte Vorstellung von der Bühnenpersönlichkeit des Künstlers machen, daß daraus das Verlangen erwächst, ihn auf der Bühne zu sehen. In wie vielen Fällen wird das eintreten?' Und wird in einem solchen Falle die Vorstellung des betreffenden Zuhörers nicht anders geartet sein als die Wirklichkeit? Wird nicht der Gegensatz zwischen Vorstellung und Wirklichkeit dazu führen, dass der Künstler mißfällt, obwohl er hätte gefallen können, wenn ihn die Phantasie des Zuhörers nicht anders zu sehen verlangt hätte, als er ist? […]
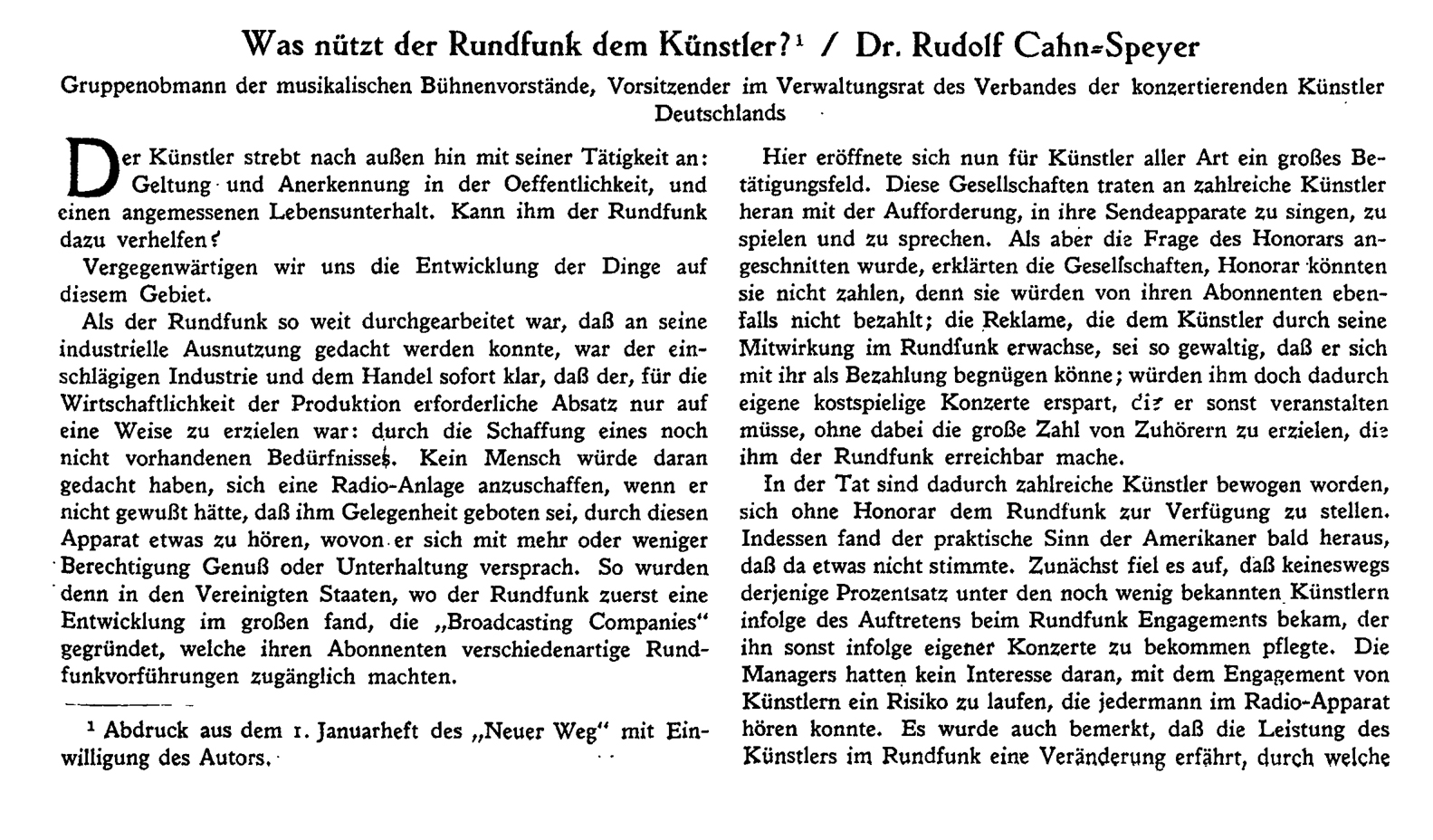
Vor 100 Jahren: Was nützt der Rundfunk dem Künstler?
So viel über den schon anerkannten Künstler. Seinem unbekannten Kollegen kommt es viel weniger auf die Zahl seiner Hörer an, als auf die Würdigung durch die Kritik. Diese aber befaßt sich nicht mit dem Rundfunk und kann sich nicht mit ihm befassen. Sie kann wohl – wie das bereits aus Kritikerkreisen angeregt worden ist – zur Zusammensetzung der Programme Stellung nehmen, nicht aber zu den Vorführungen selbst. Ich habe in der letzten Zeit eine Reihe musikalischer Fachleute darüber befragt, ob sie sich getrauen würden, die Qualität eines Sängers zu beurteilen, den sie nur durch den Radio-Apparat gehört haben, und sie haben mir ausnahmslos mit „nein“ geantwortet. Ich schließe mich persönlich dieser Meinung an. Selbst angenommen, es gäbe Radio-Apparate, bei denen jede Veränderung der künstlerischen Leistung durch technische Unvollkommenheiten oder störende Nebengeräusche unterbliebe, so hätte doch der Zuhörende kein Mittel, festzustellen, daß gerade dieser Apparat diese Vollkommenheit besitzt, und daß das, was man hört, tatsächlich die Leistung des Künstlers ist, ohne Verbesserung oder Verschlechterung. Ein Radio-Fachmann, mit dem ich kürzlich über diese Frage sprach, glaubte, den Radio-Apparat besonders zu loben, indem er sagte, man höre durch ihn noch besser als im Konzert selbst, denn man höre sogar jeden Atemzug des Sängers, auch den, den man nicht wahrnehmen könne, wenn man dabeisteht. So würde also der Radio-Kritiker, wenn es einen gäbe, bei einem Sänger falsches Atmen festzustellen haben, wenn dieser in Wirklichkeit sich nur des sogenannten „unhörbaren“ Atems bedient hat. Dies nur ein Beispiel. So ist es auch bekannt, dass mancher vortreffliche Sprecher im Radio-Apparat nicht so gut wirkt, wie mancher weniger gute.
Wir kommen also zu dem unzweifelhaften Ergebnis, daß der Künstler, was seine Einschätzung in der Öffentlichkeit betrifft, an seinem Auftreten in Rundfunk-Veranstaltungen gar kein Interesse hat, sondern nur die Funkgesellschaft. Es ist klar, dass sie dafür zu bezahlen hat. Diese selbstverständliche Forderung stößt bei uns auf Schwierigkeiten, weil der Rundfunk Monopol ist, zunächst ein Monopol des Staates, dann aber durch getroffenes Abkommen ein Monopol der im Reichsfunkverbande zusammengeschlossenen reun Funkgesellschaften. Diese brauchen also keine Konkurrem: zu fürchten, solange sie noch Künstler finden, die sich durch Scheinargumente bestimmen lassen, ohne Honorar in den Funkveranstaltungen mitzuwirken. Es liegt hier ein Fall vor, dessen befriedigende Erledigung gebieterisch vollkommene Solidarität unter den Künstlern erfordert.
Unsere Konzertsäle sind leer, unsere ernsten Theater immer schlechter besucht. Selbst Freikarten finden nur noch in beschränktem Umfange Abnehmer. Die Verschlimmerung seit der letzten Spielzeit ist so handgreiflich, und fällt zeitlich so genau mit der Verbilligung des Rundfunks durch die „Verordnung zum Schutz des Funkverkehrs“ vom 8. März 1924 zusammen, daß der Zusammenhang unzweifelhaft ist. Die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich seitdem nicht so verschlechtert, daß sie zur Erklärung herangezogen werden könnten. Wollen die Künstler sich und damit die Kunst, von der sie leben, vor solcher Schädigung schützen, so müssen sie sich für ihre Mitwirkung bei Funkveranstaltungen so honorieren lassen, daß sie außer der angemessenen Vergütung für ihre künstlerische Leistung noch eine Entschädigung erhalten für den Schaden, den sie sich selbst durch diese Mitwirkung zufügen. Keiner hat einen Schaden davon, wenn er die honorarlose Mitwirkung ablehnt.
Die Mitwirkung des Künstlers im Rundfunk bedeutet für ihn keine Stärkung seiner Geltung nach außen hin. Wird er dafür nicht angemessen honoriert, so hat er überhaupt keinen Vorteil davon, sondern nur Nachteile. Es gilt jetzt, den verkrusteten Rundfunkgesellschaften zu zeigen, daß diese Erkenntnis sich Bahn gebrochen hat, daß die Künstler nicht schlechter gestellt sein wollen als der Bürodiener einer Funkgesellschaft, und dass sie ihre Dienste verweigern, solange ihre berechtigten Ansprüche nicht anerkannt werden. Aber nur dann kann etwas erreicht werden, wenn die Künstler sich nicht gegenseitig in den Rücken fallen.
Dr. Rudolf Cahn-Speyer, Neue Musik-Zeitung, 46. Jg., Heft 10, Februar 1925
- Share by mail
Share on